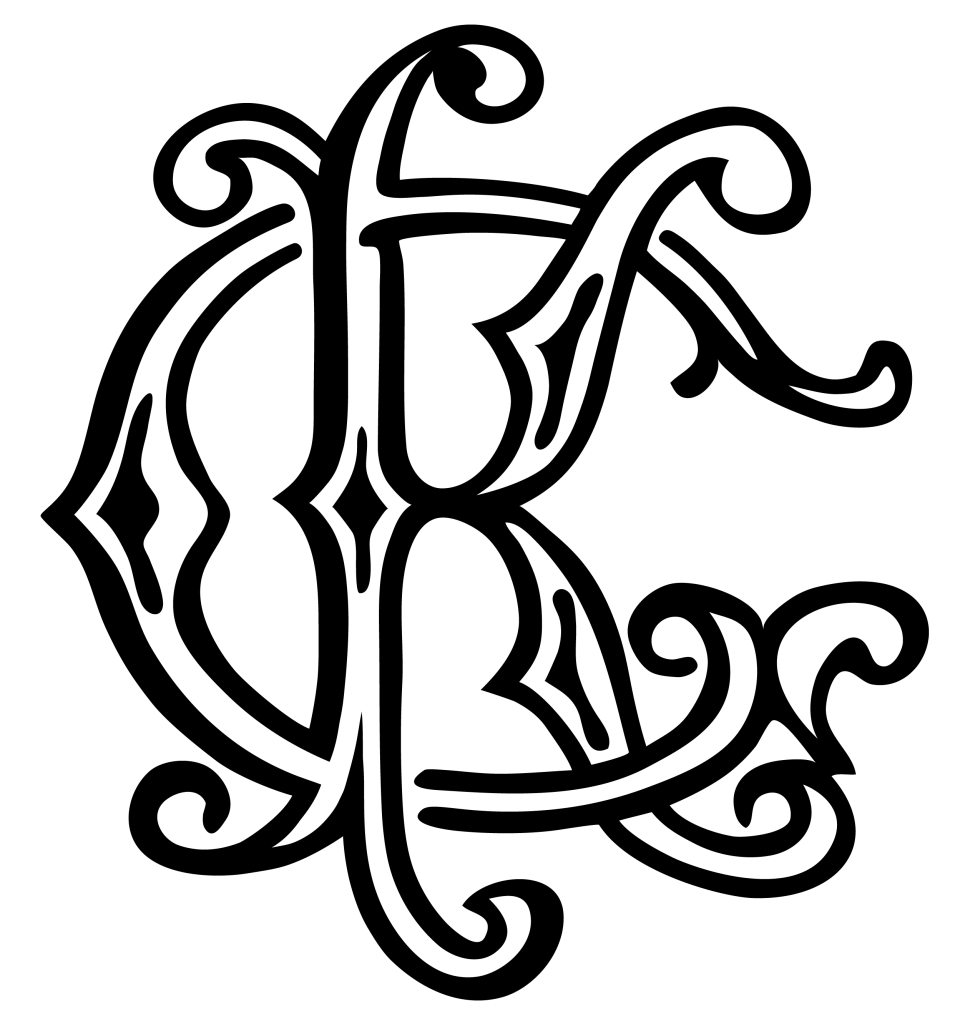Friedlich, eher unaufgeregt steht er da, der rote Backstein-Bau an der Kamminer Str./Ecke Olbersstraße. Jedoch blickt er auf eine lange, ereignisreiche Geschichte zurück: Unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde dort der Schulbetrieb aufgenommen. Bis zum gebundenen Ganztagsbetrieb im heutigen Gottfried-Keller-Gymnasium war es ein weiter Weg. Politische Veränderungen, Krieg, gesellschaftlicher Wandel und natürlich unzählige Schulreformen veränderten auch das Gesicht der Schule. Eine Konstante jedoch blieb: Schülerinnen und Schüler, die dem mächtigen Bau stets ein menschliches, freundliches und vor allem zuversichtliches Antlitz verliehen – und bis heute verleihen.
Einen Abriss Geschichte der “Schule an der Kamminer Straße” halten wir hier für Sie bereit. Im Zuge der 100-Jahr-Feier im Jahr 2019 wird eine umfassendere Schulchronik erarbeitet – seien Sie gespannt!
Als sein Gründungsdatum sieht das Gottfried-Keller-Gymnasium den 8. April 1919 an.
Die Planungen für die Errichtung der Schule gehen schon auf das Jahr 1911 zurück, in der die „städtischen Körperschaften” der damals noch selbstständigen Stadt Charlottenburg den Direktoren der Leibniz-Oberrealschule und der Herder-Schule mitteilten, dass sie zusätzlich zu ihren Klassen je eine lateinlose Sexta (5. Klasse) einzurichten hätten. „Hält der z. Zt. beobachtete Zudrang zu den lateinlosen höheren Lehranstalten an, so werden die beiden Sexten die Grundklassen einer neuen Realschule bilden.”
Der „Zudrang” hielt in der Tat an, und so wurde beim preußischen Kultusministerium der Ausbau einer zweiten Realschule beantragt. Die bereits vorhandenen und immer weiter wachsenden Klassen brachte man provisorisch dann ab Oktober 1913 in einem Schulgebäude in der Brauhofstraße unter.
Der 1. Weltkrieg ließ weitere Überlegungen zur Entwicklung der Schule in den Hintergrund treten, zu Beginn des Jahres 1919, ungefähr zeitgleich mit der Wahl zur Nationalversammlung 1919 nach dem Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreiches, wurde den Schülern und Lehrern der „Realschule II” (so lautete damals die amtliche Bezeichnung) das gerade für eine Doppelgemeindeschule fertiggestellte, aber noch nicht vollendete Gebäude in der Kamminer Straße/Ecke Olbersstraße zugewiesen, in das sie am Ende des Winterhalbjahres am 7. und 8. April 1919 umzogen.
Auf Antrag ihres ersten Direktors, Professor Neukranz, erhielt die Schule am 1. Mai 1923 den Namen „Friesen-Realschule“. Anstelle des ebenfalls vorgeschlagenen Mathematikers Gauß und des preußischen Heeresreformers Scharnhorst entschied man sich für den 1814 als Lützowscher Jäger in den napoleonischen Kriegen gefallenen Pädagogen Karl Friedrich Friesen als Namenspatron.
Aufgrund des Mangels an Lehrkräften, die größtenteils im 1. Weltkrieg gefallen waren, musste der Unterricht zeitlich und inhaltlich eingeschränkt werden. So waren im Mai 1920 neben dem Direktor nur 14 Oberlehrer und 3 technische Lehrer tätig. Die Schule hatte aber 12 Klassen mit 390 Schülern.
In den darauf folgenden Jahren stieg die Schülerzahl weiter. Man sorgte nicht nur für die wissenschaftliche Ausbildung, sondern setzte auch sportliche und musikalische Schwerpunkte. Die Friesen-Realschule gründete neben einem Ruderverein (1928) auch eine Segelgruppe mit eigener Jolle, eine Segelfliegerschar mit geliehenem Flugzeug und ein hauseigenes Blasorchester.
Durch Ministererlass des Landes Preußen vom 16. Juli 1931 wurde die Friesen-Realschule zur Oberrealschule erhoben. Als „Oberrealschule” bezeichnete man Schulen, die man mit der Reifeprüfung, dem Abitur, abschließen konnte, ohne Latein durchgängig von der 5. Klasse an belegt zu haben. Als Gymnasium wurden damals in Preußen nur Schulen bezeichnet, die man heute humanistisches Gymnasium oder altsprachliches Gymnasium nennen würde.
In den 1930er Jahren, mit Beginn der Herrschaft des Nationalsozialismus, wurde der Name Friesen zu ideologischen Zwecken missbraucht, und sogar die „Geister” Friesens und Adolf Hitlers wurden gleichgesetzt. Die NS-Rassenkunde wirkte sich auf das tägliche Schulleben aus. Von der NSDAP in den Schulen eingesetzte „Jugendwalter” hatten die Aufgabe, für die politische und rassische „Reinheit” des Lehrerkollegiums und der Schülerschaft zu sorgen.
Seit 1926 hatte Herr Dr. Gumlich in der Nachfolge von Professor Neukranz als Schulleiter die Friesen-Realschule bzw. Friesen-Oberrealschule geleitet. Im Mai 1933 sah er sich, so heißt es in einem alten Bericht, “aus gesundheitlichen Gründen” gezwungen, ein Gesuch um Versetzung in den Ruhestand einzureichen. Sein Nachfolger war Herr Schmidt, nach Berichten ehemaliger Schüler ein forscher Nazi (“Goldenes Parteiabzeichen”). Wie ehemalige Schüler berichten, merkte man die “neue Zeit” zunächst vor allem an “Äußerlichkeiten”: Jeden Montag und Samstag wurden Fahnenappelle abgehalten. Die Klassen traten wie militärische Kompanien auf dem Schulhof an. Die Nationalhymne und das Horst-Wessel-Lied wurden gesungen, der Hitlergruß musste von allen Schülern während des Appells gezeigt werden. Schüler und Lehrer kamen nun gelegentlich in Uniform zur Schule. Die religiösen Schulandachten am Montagmorgen entfielen.
Ehemalige Schüler berichten auch von Schülern, die nach und nach verschwanden – jüdische Schüler zumeist. Wenn es Widerstand gegen den Nationalsozialismus an der Friesen-Oberrealschule gab, dann gab es ihn nicht offen – zumindest geben die schulischen Quellen davon keinerlei Zeugnis. Ohnehin ist die Quellenlage für diese Zeit recht dünn, das mag aber auch damit zusammenhängen, dass durch einen Bombentreffer am Ende des Zweiten Weltkriegs sehr viele Unterlagen vernichtet wurden.
Der Sport spielte weiterhin eine große Rolle im Leben der Schule: 1938/39 kann noch ein überragender sportlicher Sieg der Friesen-Oberrealschule verbucht werden. Bei einem Fußballausscheidungskampf gegen neun andere Berliner Schulen gewinnt die Fußballmannschaft der Friesen-Oberrealschule achtmal, zum Teil haushoch.
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges war das Gebäude der Schule fast vollständig zerstört. Während der Bombenangriffe auf Berlin waren die Schüler nach Ostpreußen evakuiert worden. Am 11. August 1943 war der Transporttermin für die Friesenschule. Die Familien der Schüler konnten sich dem Transport anschließen. Etwa 650 Personen füllten schließlich die Eisenbahnwagen, das Gepäck der Reisenden und zahlreiches Schuleigentum füllte mehrere Güterwagen. Ziel war Preußisch Holland in der Provinz Ostpreußen im Regierungsbezirk Königsberg. Dort fand unter erschwerten Bedingungen gemeinsam mit einheimischen Schülern der Unterricht in der St.-Georgen-Schule statt. Mit dem Vorrücken sowjetischer Truppen begann die Flucht der evakuierten Schüler und Lehrer über Thüringen, über Greiz und Saalfeld bis nach Berlin.
Der Aufbau der im Krieg zertrümmerten Friesen-Oberrealschule ging nur mühselig voran. Im Juni 1948 beantragte der damalige Schulleiter Violet einen „dem Geist der Zeit angemessenen Namen” für die Friesen-Oberrealschule, nämlich den des Schweizer Schriftstellers und Dichters Gottfried Keller, der sein Hauptwerk „Der grüne Heinrich” und den ersten Teil seines Werkes „Die Leute von Seldwyla” während seines Berliner Aufenthaltes von 1850 bis 1855 vollendet hatte. Mit dem neuen Namen verwandelte sich auch die Friesen-Oberrealschule in ein Gymnasium, das Gottfried-Keller-Gymnasium. Zur gleichen Zeit wurden auch die ersten Mädchen an der Schule aufgenommen.
Zwei einschneidende Veränderungen in der Geschichte des Gottfried-Keller-Gymnasiums sind jüngeren Datums: Mit der Novellierung des Schulgesetztes 2004 entfielen die sog. “Aufbauklassen”, die über Jahrzehnte viele Schülerinnen und Schüler der Real- und Gesamtschulen ab Klassenstufe 9 auf die Abiturprüfung am Gymnasium vorbereitet hatten. Mit der großen Schulstrukturreform in Berlin 2010 wurde das Gottfried-Keller-Gymnasium zum Ganztagsgymnasium umgewandelt. Die nötigen zusätzlichen Raumkapazitäten für den Ganztagsbetrieb wurden dadurch frei, dass die bis dahin im gleichen Gebäude untergebrachte Elisabeth-Realschule mit der ehemaligen Oppenheim-Hauptschule zur Sekundarschule am Schloss fusionierte und auszog. Die mit dieser Veränderung verbundenen enormen strukturellen, finanziellen und baulichen Veränderungen wurden in einer bislang beispiellos engen und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulaufsicht und Schulträger gemeistert.
Die fünf letzten Schulleiter des Gymnasiums waren Herr Puhlmann (1949-1957), Herr Dr. Harald Scherrinsky (1957-1977), Herr Arnim Zöller (1977-1991), Herr Günter Umlauft (1991-2006) und Herr Eberhard Kreitmeyer (2007-2016). Heutiger Schulleiter ist Herr Uwe Kany (seit 2016).
Nach einem Entwurf von Magistratsbaurat Hans Winterstein begann man unter Mitwirkung von Magistratsbaurat Rudolf Walter Ende 1914 mit den Arbeiten für eine Gemeinde-Doppelschule. Dazu war eine Bausumme von 1.059.000,– Mark vorgesehen.
Mitten im Krieg, im Jahr 1916, war der Rohbau beendet. Vermutlich haben schon 1917 die ersten Klassen, von der Herder-Schule ausgelagert, den Schulneubau genutzt, und zwar im südlichen Teil. 1918, zum Kriegsende, kamen die Bauarbeiten zum Erliegen.
Nach Informationen des Bezirksamts wurden die Bauarbeiten etwas später als sog. “Notstandsarbeit” wieder aufgenommen, sodass im Mai 1919 auch der nördliche Bauteil fertiggestellt werden konnte. Am 8.4.1919 wurde der Schulbetrieb offiziell aufgenommen. Am 1.5.1923 erhielt die Schule den Namen Friesen-Oberschule nach dem in den napoleonischen Kriegen gefallenen Pädagogen Karl-Friedrich Friesen (1785-1814).
Der nördliche, etwas längere Gebäudeteil des Schulgebäudes erstreckte sich aber noch nicht wie heute bis zur Olbersstraße. Er endete in Höhe des jetzigen Eingangs D, der vom Gottfried-Keller-Gymnasium als Haupteingang benutzt wird. 1930 wurde an diesen Gebäudeflügel ein weiterer Flügel angebaut, weil man noch Platz für eine “Hilfsschule” brauchte (die heutige Arno-Fuchs-Schule im Bezirk). Der Architekt dieses Flügels war Magistratsbaurat Josef Reuters. Noch heute erkennt man den Anbau, der äußerlich angepasst wurde, am baubedingt kleineren Schnitt der Unterrichtsräume und der baulichen “Abschottung” der Gebäude im Erdgeschoss.
Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude teilweise zerstört. Es war aber noch so weit intakt, dass das in der Tauroggener Straße 36 zerstörte Kino “Orpheum-Lichtspiele” in der Aula, die in enger Reihenbestuhlung 413 Plätze fasste, untergebracht werden konnte. Ende 1959 wurde die Aula, da sie ja als Kino schon hergerichtet war, als “Filmtheater der Charlottenburger Schulen” eingeweiht. In die Nachkriegszeit fällt auch der Beginn der Mehrfachnutzung des Gebäudes: Zusätzlich zur Friesen-Oberschule bezog die Westpreußen-Oberschule, eine Hauptschule, den südlich gelegenen, kürzeren Flügel, bis in den Siebziger Jahren die Elisabeth-Oberschule (Realschule) aus der Schustehrusstraße 39-43 in diesen Flügel einzog. 1983 zog die Arno-Fuchs-Schule aus und in ihr heutiges Domizil, den Schulneubau in der Richard-Wagner-Straße.
1948 erhielt die Schule den Namen Gottfried-Keller-Oberschule. Mit der Namensgebung wurde an den Schweizer Schriftsteller und Dichter Gottfried Keller (1819-1890) erinnert.
Bereits 1951 wurde an die Rückseite des Nordflügels eine Sportbaracke angebaut, die Umkleideräume für den Sportplatz Olbersstraße (heute Sportplatz Brahestraße) beherbergte. Die Lage dieser ehemaligen Sportbaracke ist heute noch an den Umrissen unserer Terrasse hinter dem Schulgebäude zu sehen.
Durch die Bauarbeiten an der Verlängerung der U-Bahn-Linie 7 nach Spandau wurden auch Schulgelände und Schulgebäude stark in Mitleidenschaft gezogen und deshalb 1979 grundlegend saniert. Nach der Sanierung zog zusätzlich zu den beiden Schulen auch noch eine Kindertagesstätte des Pestalozzi-Fröbel-Hauses in das Gebäude ein, und zwar in das Erdgeschoss jenes ehemaligen Anbaus zur Olbersstraße hin, der ursprünglich für die “Hilfsschule” 1930 errichtet worden war.
Im Jahr 2006 zog die Kindertagesstätte aus und 2007/2008 wurden die Räumlichkeiten zu einer Mensa für die beiden Schulen umgebaut.
Wegen der architektonischen Gestaltung (Klinkerbau, Formsteine, sehr zurückhaltender Reliefschmuck) und der Einpassung in das architektonische Ensemble nordwestlich des Mierendorffplatzes wurde das Schulgebäude im Februar 1998 in die Berliner Denkmalliste aufgenommen.
Am 25.06.2011 wurde der nach Schülerentwürfen neu gestaltete Schulhof eröffnet. Die Gestaltungsideen waren aus einer Beteiligung am Senatsprojekt “Grün macht Schule” hervorgegangen.
Mit die größten Einschränkungen baulicher Art für die GKS nach dem 2. Weltkrieg stellten die Arbeiten an der Verlängerung der U 7 von Richard-Wagner-Platz nach Rohrdamm dar. Ende der 70er Jahre wurde gebaut. Dabei musste sowohl der Schulhof Kamminer Straße/Olbersstraße aufgerissen werden als auch der Sportplatz. Die kleine nachfolgende Fotogalerie zeigt Eindrücke aus dieser Zeit, teilweise durch Lücken im Bauzaun fotografiert!
Buntes Mosaik aus den letzten Jahren der Friesenschule 1945-1948*)
“Lest we forget, lest we forget” (Damit wir es nicht vergessen … )
(Refrain des Gedichtes “Recessional” von R. Kipling, das er zum sechzigjährigen Regierungsjubiläum der Königin Viktoria dichtete. Er mahnt darin, dass England bei allem Glanz des Jubiläums nicht die Lehren der Vergangenheit vergessen und übermütig und prahlerisch werden soll.)
Juni 1945
Vor meiner Tür liegt eine etwas schmuddelige Postkarte ohne Marke, ohne Stempel; denn die Post funktioniert noch nicht. Ein Schüler muss sie „privat“ befördert haben. (So etwas war damals üblich.) – „Bitte kommen Sie an einem der nächsten Vormittage in die Friesenschule, Charlottenburg, Kamminer Straße 17/18. Violet, Direktor“. – Ein geretteter Stadtplan zeigt die Lage. Es gibt noch keinerlei Verkehrsmittel. Also eine Dreiviertelstunde Fußweg.
Ruinen, Ruinen, Ruinen! – Charlottenburg, Schlossstraße. – Im Hintergrund das halbzerstörte Schloss! – Steht die Schlossbrücke noch? Ja, beschädigt; aber man kann hinüber. – Tegeler Weg, Kamminer Straße. Jetzt muss die Schule gleich kommen. Gespannt folge ich den Hausnummern. Da ist sie!
Ach du lieber Gott! Ein scheußlicher roter Kasten! Das halbe Dach fort. Dachsparren ragen schwärzlich in den blauen Himmel. Keine einzige Fensterscheibe!
Es ist Vormittag, und doch ist es unheimlich still. – Ist die Schule ganz tot? – Nein, ein paar lange Kerle schleppen uralte zweisitzige Schulpulte über den Hof. Sicher meine zukünftigen Schüler. – Solche Riesen! Ach du lieber Gott! Vor dem Kriege unterrichtete man als Frau normalerweise nur an Mädchenschulen! Die einzigen Jungen, mit denen ich bis jetzt Erfahrung habe, sind meine beiden Söhne (drei Jahre bzw. neun Monate alt). – Egal! Diese hässliche Ruine bedeutet Brot für uns drei. Also vorwärts!
Ein kleiner älterer Herr kommt mir entgegen, und zum dritten Mal denke ich: Ach du lieber Gott! Ein verquollenes rotes Gesicht schaut mich an. Wie konnte ich ahnen, dass der Arme im Anfangsstadium einer Gesichtsrose war? – Ich versinke in einem Unikum von Sofa. Schwarzes Wachstuch mit aufgeklebten Flicken. (Wer erinnert sich noch?) –
Dann beginnt ein scharfes Frage- und Antwortspiel, mit dem dieser kleine Herr sich höchst energisch und zielbewusst ein Bild von mir zu verschaffen sucht und mit dem ein ausgezeichnetes Arbeitsverhältnis zwischen uns beiden beginnt. (Aber das ahnte ich damals natürlich noch nicht.) Am Schluss stelle auch ich eine Frage, eine einzige, aber für mich entscheidende Frage: „Wenn ich jetzt hier anfange, will ich auch hier bleiben. Kann ich aber an einer Jungenschule bleiben, wenn später die Lehrer zurückkommen?“ Die kleinen verquollenen Äuglein blicken mich wohlwollend an: „Ich kann noch nichts versprechen; aber ich habe die Absicht, hier Koedukation einzurichten. Da wären Sie als Frau geradezu nötig.“ – Koedukation! Auch das noch! Innerlich entringt sich mir das vierte „Ach du lieber Gott!“ – Dass Koedukation sehr fruchtbar und erfreulich sein kann, wusste ich damals eben auch noch nicht.
7. Juli 1945
An diesem Tage begann mein Dienst an der Friesenschule, aber zunächst ohne Direktor Violet. Der lag schwer krank an Gesichtsrose. Wir waren vier Lehrer (von denen nur Herr Dr. Krueger auch heute noch an unserer Schule ist). Wir begannen mit unserer ersten Konferenz. Das ging sehr schnell. Vier Lehrer waren wir, also konnten wir vier Klassen aufmachen. – „Was können Sie geben?“ ging es reihum. Geschichte und Erdkunde durften auf Befehl der Besatzungsmächte nicht, Physik und Chemie konnten anfangs noch nicht gegeben werden, weil die Räume in wüster Unordnung waren und weil bei Regen das Wasser bis in den dritten Stock herunter lief. (In der Aula waren die Regenspuren noch bis 1960 zu sehen!) – In einer Stunde war nicht nur die Stunden- und Klassenverteilung, sondern auch der Plan fertig. Am nächsten Tage begann die Schule.
Ja, sie begann, aber wie! Fenster? Gab’s nicht! Zunächst war ja Sommer, später wurde ein kümmerlicher Ersatz aus Pappe und abgewaschenen, zusammengenähten Röntgenfilmen geschaffen. Türen? Gab’s zum Teil auch nicht, oder die Klinken fehlten. Da stand man eben im Zug. Bücher? Gab’s nicht. Ein einziges englisches Übungsbuch aus meiner eigenen Schulzeit (vor 1933, also nicht verboten) bildete die Grundlage meines englischen Unterrichts. Hefte? Gab’s nicht. Alte Zettel taten es im Anfang auch, sogar für Klassenarbeiten! Tinte? Gab’s oft auch nicht. Da schrieb man eben mit Bleistiftstummeln; denn Kugelschreiber existierten damals in Deutschland noch nicht. Schwämme? Gab’s nicht. Manchmal stiftete eine Mutter einen alten Lappen. (Wie bloß die Schüler damals die Schule ohne Schwammschlachten ertragen haben?) Kreide? Gab’s nicht. Wenn man welche brauchte, bat man die Schüler, ein paar Stücke Kalk aus einer Ruine zu besorgen. Kalk hatten wir immer reichlich!! Lest we forget, lest we forget …
Disziplin? Gab’s!!! Vielleicht war das gar nicht verwunderlich. Allmählich kamen immer mehr Schüler und auch einige Lehrer der alten Friesenschule zurück (Herr Hintze, Herr Braun, Herr Lieske). Manche Jungen schlugen sich von Thüringen, wohin die Schule offiziell evakuiert worden war, und von anderen privaten Evakuierungsorten – oft allein – zwischen den russischen Truppen nach Berlin durch. Viele hatten dabei und beim Kampf um Berlin Grauenvolles erlebt oder mit angesehen. Die Lebensläufe der ersten Abiturientenjahrgänge waren oft erschütternd! – Ja, Abiturienten gab’s damals auch! Vielleicht wissen unsere heutigen Abiturienten, die wieder 13 ungestörte Schuljahre hinter sich haben und – von Einzelfällen abgesehen – ungestört haben lernen dürfen, mehr als die damaligen Abiturienten, deren Schulzeit durch Bombennächte, Evakuierungen, ausgebrannte Wohnungen, den Verlust der Eltern und die Forderungen des „Dritten Reiches“ bedroht wurde. Aber wenn sie auch heute oft eine größere „Bildung“ haben, ich glaube, das „Zeugnis der Reife“ hat damals manch einer mit mehr Berechtigung empfangen. Vielleicht waren diese gehetzten Jungen von damals im Geheimen froh, dass sie wieder in die Welt der Schule zurückkamen, in eine Welt, in der es ein bisschen Ordnung, Gerechtigkeit und eine wenn auch kümmerliche Geborgenheit gab, auch wenn diese Welt von hässlichen und defekten Wänden umschlossen war.
Ach, groß war die Geborgenheit dieser Welt zunächst gewiss nicht. Wie oft kamen wir in diesen ersten Tagen in die Schule, und die mühsam hergestellte erste Ordnung und Sauberkeit war zerstört: Nachts hatten wieder russische Truppen in der Schule geschlafen, weil es in der Turnhalle noch alte Matratzen gab. Erst als die eines Tages verbrannt waren, wurde es besser.
Nie werde ich vergessen, wie ich während einer Unterrichtsstunde Marschtritte hörte, mich ans Fenster schlich und eine ganze Abteilung Russen in den Schulhof marschieren sah. Und ich war die einzige Frau im ganzen Gebäude! Ich unterrichtete weiter, denn es schien mir das Wichtigste, die Klasse ruhig zu halten. Nach einer – wie es mir schien – Ewigkeit trappte es wieder. Noch mehr Russen? Wieder schlich ich mich zum Fenster. Nein, sie marschierten ab, vielleicht weil es keine Matratzen mehr gab, vielleicht auch, weil sie sahen, dass die Schule in Betrieb war; denn Schulen genießen bei den Russen bekanntlich großes Ansehen! – Ich weiß nicht, ob die Schüler den Zwischenfall überhaupt bemerkt haben. Den Stein, der mir vom Herzen fiel, den hätten sie eigentlich hören müssen.
Übrigens war ich nur jeden zweiten Tag die einzige Frau im Gebäude, denn dreimal in der Woche kam die Sekretärin Frau Schulze in die Schule. Für eine volle Beschäftigung reichte die Arbeit an unserer Schule damals noch nicht aus! Wie viele haben wohl damals gewusst, dass der erste Nachkriegsdirektor unserer Schule eigentlich Herr Schulze hieß, dass er aber, bevor er sein Amt antreten konnte, einem Unglücksfall zum Opfer fiel, und dass man Frau Schulze, da es damals keine Pensionen gab, die SekretärinnensteIle sozusagen als Ersatz angeboten hatte? Und die tapfere Frau Schulze hat sie angenommen und ist viele Jahre lang ein guter Geist unserer Schule gewesen.
Im August kam dann die Schulspeisung (soviel ich weiß: in Charlottenburg als erstem Berliner Bezirk). Da ich die einzige Lehrerin war, drückte man mir selbstverständlich und buchstäblich die Essenkelle in die Hand, und es war auch nötig, dass ein Lehrer sie schwang, denn eifersüchtig wurde beobachtet, ob die Kelle jeweils voll genug, aber nicht zu voll war. Über „Nachschlag“ und Auskratzen der Thermophore musste genau Buch geführt werden. Diese Schulspeisung war damals eine wunderbare Sache! Jeder nahm teil, und wenn ein Schüler krank war, kamen Vater oder Mutter in der Essenpause, um die kostbare Nahrung selbst zu holen. – Lest we forget, lest we forget …
Und dann kamen ganz vereinzelt die ersten Mädchen, erst eins, dann zwei, dann drei, und dann musste sich die Jungenschule ein bisschen umstellen. Es musste z.B. eine Mädchentoilette eingerichtet werden. Und ganz hat man es ja auch heute noch nicht geschafft! (Siehe Waschräume der Mädchen in der Turnhalle!)
Im ersten Winter kam die „Aktion Storch“. Wieder wurden ein Lehrer und einige Schüler verschickt. Wir anderen froren und hungerten uns durch den Winter, ohne Fenster, ohne Heizung, in ungenügender Kleidung. Während der richtigen Kälte fiel in diesem wie im folgenden Winter die Schule aus. Nur Schulspeisung gab es jeden Tag. Jeden Tag kamen alle Schüler, um sie zu holen. Jeden Tag ordneten Herr Braun und Herr Dr. Krueger die immer größer werdenden Schülerscharen nach Klassen alphabetisch, bevor sie sich an den großen Thermophoren vorbei schoben. Ohne die Hilfe meiner Kollegen wäre ich nie mit dieser verhungerten Schar fertig geworden. – Lest we forget, lest we forget …
Hunger und Kälte, das waren unsere gemeinsamen Feinde! Wieder möge ein persönliches Erlebnis das illustrieren: Jedes Mal, wenn ich heute in meinem Wagen an der bekannten „abgeknickten Vorfahrt“ von der Schloßbrücke zum Tegeler Weg halte, weil der Verkehrspolizist den Verkehr stoppen muss, damit die Verkehrsteilnehmer aus der Tauroggener Straße auch mal durchkommen, dann steht vor meinen Augen ein anderes Bild: Dieselbe Ecke 1945! Da fuhr ein paar Mal in der Woche ein Wagen mit Koks in die französische Kaserne, und an dieser Kurve fielen gewöhnlich ein paar Stücke herunter. Ich hatte dafür einen kleinen Beutel an meinem klapprigen Fahrrad hängen. Lag Koks da, so stieg ich ab und sammelte in aller Ruhe die Kostbarkeit ein, ohne mich und den „Verkehr“ zu gefährden. Aber wenn man dabei in einer Hand ein Fahrrad balancieren muss, so ist das etwas unbequem! Doch selbst die brüchige Mühle, die ich notdürftig fahrbar gemacht hatte, war damals ein Wertgegenstand, und so wagte ich nicht, sie auch nur einen Augenblick aus der Hand zu lassen. Ich war also sehr erfreut, als eines Morgens ein Schüler vor mir stand, der höflich fragte, ob er mir solange das Rad halten dürfe. Ich drückte es ihm dankbar in die Hand, sammelte „meinen“ Koks ein, schwang mich wieder aufs Rad und fuhr zur Schule. Meine Autorität hat nicht ein bisschen darunter gelitten; denn die Schüler wussten, das bedeutete eine warme Mahlzeit für meine Kinder und mich, und den Wert einer warmen Mahlzeit wusste damals jeder zu schätzen. – Lest we forget, lest we forget …
Im zweiten Winter lief alles genauso, und als wir die ersten einfachen Fensterscheiben bekamen, erschien uns das als ungeheurer Luxus. Dass Kinder einen Tag fehlten, weil „die“ Hose gewaschen werden musste oder weil „die“ Schuhe beim Schuhmacher waren oder weil sie in die Zone fahren mussten (das konnte man damals noch), weil sie eine Kartoffelquelle für die Familie hatten, waren anerkannte Gründe auf Entschuldigungszetteln. – Lest we forget, lest we forget …
1948
Eines Tages gab es große Aufregung: Ostmark – Westmark! Drohung der Russen! Aber das Geld wurde schließlich doch umgetauscht, und wir Lehrer, wir „Mädchen für alles“, saßen den ganzen Tag und zählten und wechselten, und das Publikum schob sich je nach Temperament träge, erregt, besorgt, begeistert, nörgelnd an unseren Tischen vorüber. – Dann gab es eine Mittagspause und Verpflegung, reichliche, gute Verpflegung. Zum ersten Mal seit langer Zeit war ich satt, richtig satt! – Etwas müde saß ich neben Direktor Violet, als er mir einen Zettel mit dem einfachen Stempelabdruck „Gottfried-Keller-Schule, Berlin-Charlottenburg“ hinschob. Verständnislos sah ich ihn an. „Wie finden Sie den Namen?“ Ich begriff immer noch nicht. „Friesenschule kann die Schule doch nicht mehr heißen.“ (Warum eigentlich nicht? Zunächst hatte ich dabei immer an den Volksstamm gedacht, bis ich erfahren hatte, dass sie zu Ehren eines Mannes so hieß.) „Ich habe den Namen Gottfried-Keller-Schule vorgeschlagen“, fuhr Direktor Violet stolz fort. „Gestern habe ich die Genehmigung inoffiziell bekommen“. – Ein gewisser Ärger meldete sich bei mir. Muss denn alles umbenannt werden? Friesen war doch bestimmt kein Nazi. Hätte man uns als Beteiligte nicht wenigstens mal fragen können? Aber der Stempel schien es mir zu beweisen: Es war mal wieder alles bereits passiert.
Schließlich – war es so wichtig? War das Geschick Berlins, die Spannung und Unsicherheit, die uns in jenen Tagen beherrschte, nicht wichtiger? – Und dann begann das Gedächtnis des Deutschlehrers zu arbeiten: Gottfried Keller – „Der Grüne Heinrich“ – „Die Leute von Seldwyla!“ – Seldwyla ist nach Keller ein „sonniger, wonniger Ort“ in der Schweiz … (Ach, ob man je wieder in die Schweiz fahren könnte?) – „Das Fähnlein der sieben Aufrechten“ … Davon sollte man mehr in Deutschland haben … „Kleider machen Leute“ mit Wenzel Strapinski, dessen Hochstapelei durch eine reichliche Mahlzeit nach langer Hungerei ausgelöst wird … konnte ich verstehen, konnte ich im Augenblick sehr gut verstehen … „Frau Regel Amrain und ihr Jüngster“ … Frau Regel, die mit Humor und Festigkeit ihren jüngsten Sohn zu einem aufrechten und freiheitsliebenden Demokraten erzieht … Wenn schon eine Namensänderung sein musste, dann fand ich: Gottfried Keller mit seinem durch viele Enttäuschungen und Schicksalsschläge gereiften Humor, mit seinem verständnisvollen Augenzwinkern für die komischen Käuze, mit seiner Liebe zu seinem Volk – dieser Gottfried Keller ist kein schlechter Namenspatron für eine Schule. Damals bekam also Berlin die Westmark … und die Gottfried-Keller-Schule! Lest we forget, lest we forget … Damit wir es nicht vergessen …
*) Man möge die sehr subjektive Form der Bilder verzeihen. Sie soll nur dazu dienen, die Atmosphäre jener Jahre noch einmal zu beschwören.
(Erkika Vetter, aus: Festschrift zum 50jährigen Bestehen der Gottfried-Keller-Schule, vormals Friesen-Oberrealschule, Berlin-Charlottenburg 1961)
Wohl eher zufällig kam, wie im obigen Artikel zu lesen ist, die Gottfried-Keller-Schule 1949 zu ihrem Namen. In dem Chaos des Zusammenbruchs und der Not der jäh Berlin abschnürenden Blockade wollte man vom revolutionären Elan und der sportlichen Wehrertüchtigung Friesens wenig wissen (die Schule hieß seit 1923 „Friesen-Schule“) und meinte mit Keller einen abgeklärten, resignierend-humorvollen Namenspatron gefunden zu haben. Bei näherer Betrachtung der literarischen Hauptwerke Kellers, seiner beiden Romane „Der grüne Heinrich“ und „Martin Salander“, zeigt sich jedoch, dass man aus der Not der zufälligen Namensgebung leicht eine pädagogische Tugend machen kann: Wie kaum ein anderer Autor seiner Zeit setzt sich unser Schweizer Autor intensiv mit der Erziehungstheorie, Schulpolitik und Schulwirklichkeit seiner Zeit auseinander. Lassen wir das literarische Schema „Bildungsroman“ außer acht, mit dem „Der grüne Heinrich“ immer etikettiert wurde, und betrachten wir statt dessen die Darstellung der Institution Schule im Roman.
Heinrich Lee tritt zunächst in die Armenschule ein, deren Träger ein gemeinnütziger Verein, nicht aber die Öffentlichkeit des Kantons ist. Während die Misere des Landschulwesens in der Schweiz vor der Gründung des Erziehungsrates 1831 bekannt ist (Schulmeister waren durchweg in anderen Berufen gescheiterte Existenzen, die, fachlich und pädagogisch unfähig, für einen Lohn arbeiteten, der unter dem eines Fabrikarbeiters oder Nachtwächters lag, die Kinder waren zu Dutzenden in dunkle Gebäude eingepfercht) wird hier die „Pestalozzi-Lancastersche Unterrichtsweise angewendet, und zwar mit einem Eifer und einer Hingebung, welche gewöhnlich nur Eigenschaften von leidenschaftlichen Privatschulmännern zu sein pflegen.“ Während der „Oberlehrer“ über allen (bis zu 100!) Kindern thronte und sie überwachte, arbeiteten „Monitoren“, d.h. ältere Schüler, die im Stoff schon weiter waren, mit Gruppen von Kindern, dies nach der Methode Bell-Lancaster: Bei Gottfried Keller in Koedukation von Mädchen und Jungen, und, da die Stühle nicht reichten, auf Klingeln des Lehrers mit einer Glocke im abwechselnden Sitzen und Stehen.
Entspricht die Idee einer allgemeinen, freilich immer noch ständisch gebundenen Volkserziehung der Vorstellung Pestalozzis und trifft auch das Empfinden Heinrichs, Schule sei etwas „Kurzweiliges“, was man gerne tue, die Intention des großen Schweizer Reformers, so verschweigt Keller nicht die Schattenseiten einer Schule im Umbruch, die organisatorisch- methodisch noch immer an den Übeln eines unliberalen Calvinismus und der Herkunft der „Lehrer“ aus den ungebildeten Ständen krankt: Heinrich empört sich mit jugendlichem Gerechtigkeitssinn über das rituelle, öffentliche Zelebrieren von Schulstrafen, zu der auch die körperliche Züchtigung gehört, und das bloße, geistlose Auswendiglernen und Abprüfen des Katechismus, eines „kleinen Buches voller hölzerner, blutleerer Fragen und Antworten“. Berühmt ist die – stark biographisch verankerte – Episode vom Schulausschluss des grünen Heinrich. Zum historischen Hintergrund: Gottfried Keller kam 1833 in die neu gegründete kantonale Industrieschule, die zu technischen, gewerblichen und handwerklichen Berufen hinführte. Sein Mathematiklehrer, der Liberale Johann Heinrich Egli, der selbst Mitglied des progressiven Erziehungsrates war, eckte zunächst bei älteren Schülern und Eltern, dann auch bei den „Kleinen“, zu denen Gottfried gehörte, wegen unklarer Unterrichtsgestaltung, willkürlicher Zensurengebung und ruppigen Lehrerverhaltens an. Der Erziehungsrat halbierte Egli die Stelle, um Ruhe in die Schule zu bekommen. 20 seiner ehemaligen Schüler aus der dritten Klasse wollten ihre Rechenhefte vom ehemaligen Lehrer zu Hause abholen (der heutige Pädagoge registriert, dass es auch damals schon Kollegen gab, die sich mit den Korrekturen übergebührlich Zeit ließen), und es kommt zu dem berühmten Demonstrationszug der Schüler zum Hause Eglis, der in einem Tumult endet und zur Verweisung des jungen Gottfried Keller führt, nachdem eine Untersuchungskommission eingesetzt wurde.
Wie gestaltet Keller dieses Ereignis in seinem Roman? Bereits die Kapitelüberschrift „Ungeschickte Lehrer, schlimme Schüler“ gewichtet und wertet das Geschehen differenziert. Eingebettet in das politische Umfeld der Auseinandersetzung zwischen Liberalen und Aristokraten entbrennt ein Kampf zwischen dem Schulmeister und seinen Zöglingen, der sich so „hochschaukelt“, bis der Lehrer sich schließlich überhaupt nicht mehr durchsetzen kann und sozusagen das Handtuch wirft: „Der Unglückliche war ein Ableiter für allen bösen Stoff, welcher in der Schule steckte. So schleppte er sich beinahe ein Jahr hin, bis er endlich für eine Zeitlang suspendiert wurde. Er wäre so gerne ganz weggeblieben, indem er Schaden an seiner Gesundheit litt und ganz abmagerte; aber eine zahlreiche Familie schrie nach Brot, und er war auf diesen Beruf angewiesen. So trat er eines Tages seinen Leidensweg wieder an, so versöhnlich und bescheiden als möglich; allein er fand keine Barmherzigkeit; ein wilder Jubel brach los, das alte Unwesen wiederholte sich, und er musste nach wenigen Tagen gänzlich entlassen werden.“
Nicht gezielte Boshaftigkeit, sondern einfach das Fehlen von Autorität lässt die Kinder handeln, die, in das Korsett eines calvinistischen Schulsystems gespannt, da „Dampf ablassen“, wo sich eine Ventilfunktion darbietet. Der Revolutionszug zum Hause des Unglücklichen folgt ganz dem Gesetz der Massenpsychologie, wie es im Buche steht: „Ich kann mir fest gestehen, dass ich mich damals über die Freude (die Freude, als Organisator des Widerstandes von der Gruppe anerkannt zu werden) selbst freute und keinerlei Bosheit in mir trug. Vielmehr empfand ich heimliches Mitleid mit dem Armen, welches ich zu äußern aber unterließ, um nicht lächerlich zu werden.“
Die Episode könnte noch heute Stoff für eine Sitzung im Schulpraktischen Seminar für Studienreferendare sein, da die psychologischen Konstituenten anscheinend zeitlos schultypisch sind, solange Schule als lehrerzentrierte Zwangsveranstaltung erlebt wird: Didaktische Fehler des Lehrers, die Klasse schließt sich als Gemeinschaft im Widerstand zusammen, den der Lehrer nicht aufbrechen kann, Gruppenzwang innerhalb der sogenannten „peer-group“ lässt kein Nachgeben zu, Wirkungslosigkeit der Sanktionen, Verlust der Autorität.
Keller zeigt uns jugendliche Delinquenz, skurrile Lehrerpersönlichkeiten und ein Schulsystem im Umbruch. Erstaunt über die Macht des Wortes ist der grüne Heinrich, als er „verbotene Wörter“ ausspricht und die Reaktion der Erwachsenen bemerkt. Er denunziert drei andere, ältere Schüler und spinnt eine Lügengeschichte, die ihm, wie er verwundert registriert, auch abgenommen wird. Das „System“ Schule greift, ohne Nachprüfung der Geschichte wird geahndet. Auch hier zeigt Gottfried Keller, dass sich der Apparat Schule geradezu konditionieren lässt. Ein Reiz- Reaktionsschema läuft ab, das Verhängnis nimmt seinen Lauf.
Dass der selbst auferlegte Zwang der Vorbildfunktion aus Lehrern zuweilen wunderliche Propheten macht, wenn die gesunde Erdhaftigkeit fehlt, beweist das Kapitel „Der Philosoph und der Mädchenkrieg“. Ein „blutjunges Schulmeisterlein von kaum 17 Jahren“ tritt in den Dienst, der sich selbst der „Philosoph“ nennt. Er lernte alle philosophischen Bücher, derer er habhaft werden konnte, auswendig und behauptete: „Der beste Volksschulmeister sei nur derjenige, welcher auf dem umfassenden Blick über alle Dinge das Bewusstsein bereichert mit allen Ideen der Welt, zugleich aber in Demut und Einfalt, in ewiger Kindlichkeit wandelnd unter den Kleinen, womöglichst unter den Kleinsten.“
Die Vorbildfunktion nimmt er wahr, indem er selbst nach den alten Philosophenschulen der Antike leben möchte und in seinem Habitus eine Art „fundamentalistische Alternativen“ vorformt: „Als Kyniker schnitt er alle überflüssigen Knöpfe von seinem Rocke, warf die Schuhriemen weg und riss das Band von seinem Hute, trug einen derben Prügel in der Hand, welcher zu seinem zarten Gesichtchen seltsam kontrastierte, und legte sein Bett auf den bloßen Boden; bald trug er sein schönes Goldhaar in langen, tausendfach geringelten Locken, bald schnitt er es so dicht am Kopfe weg, dass man mit dem feinsten Zängelchen kaum ein Härchen hätte fassen können…“
Glaubt Keller im „Grünen Heinrich“ noch unter dem Einfluss von Pestalozzis Roman „Lienhard und Gertrud“ an die Idee der allgemeinen Volkserziehung, so kehrt er sich unter dem Eindruck des Referendums von 1869 (Annahme der demokratischen Verfassung von Zürich) von diesem Ideal ab und konzipiert mit seinem Spätwerk „Martin Salander“ einen Gegenentwurf zu seinen früheren pädagogischen Idealen. Obwohl sein Held Martin Salander äußerlich noch dieses Vorbild biographisch darstellt (erst die Ausbildung zum Lehrer, dann erfolgreicher Geschäftsmann, schließlich uneigennütziger Politiker) widerlegen Handlung des Romans und die anderen Figuren den aufklärerischen Idealismus und zeigen die Hinfälligkeit dieses Optimismus vor dem Hintergrund der Schweizer Gründerjahre, deren auffälligstes Merkmal, das Winterthurer Eisenbahnunternehmen, literarisch als Motiv in den Roman eingearbeitet wird.
Martin Salander führt seiner Frau gegenüber aus, dass kein Jüngling vor dem 20. Lebensjahr aus der Schule entlassen werden dürfte. Mathematik, schriftlicher Ausdruck, Biologie, Gesundheitspflege, Landeskunde, Geschichte, Turnen, militärische Schießübungen, Gesang und Musik… Eine übervolle Stundentafel, selbst für heutige Abiturienten! „Was sollen sie denn so lange treiben?“, wendet Frau Salander ein und lässt ihren Mann mit den Worten verstummen: „Ich meine den schrecklichen Kriegszug, welchen die Schweizer nach Asien oder Afrika werden unternehmen müssen, um ein Heer von Arbeitssklaven, oder besser, ein Land zu erobern, das sie liefert. Denn ohne Einführung der Sklaverei – wer soll denn den ärmeren Bauern die Feldarbeit verrichten lassen, wer die Jünglinge ernähren? Oder wollt ihr diese besolden, bis sie 20 Jahre alt sind und dann alles verstehen, nur nicht zu arbeiten?“
Dr. Lutz Rosenplenter (überarbeitet von Uwe Kany)